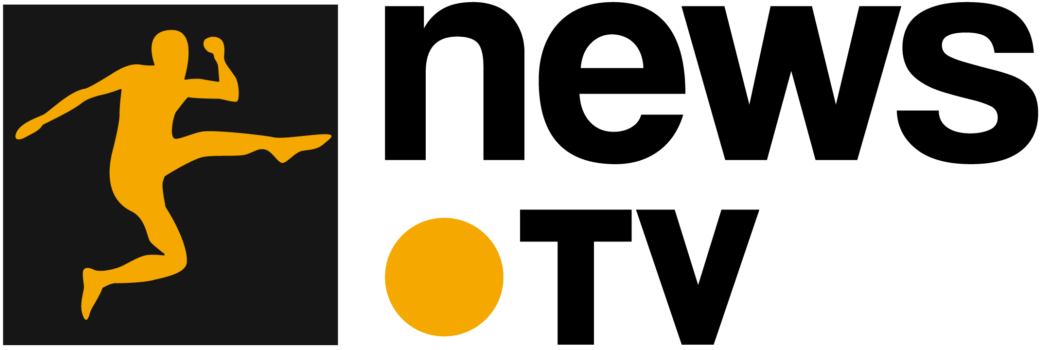In diesem Stadion wird nicht ein einziges WM-Spiel ausgetragen und trotzdem sind die Tribünen jeden Abend voll. Wer rechtzeitig gekommen ist, hat noch einen Platz gefunden. Andere hocken unten auf dem vergilbten Rasen, den Blick gebannt auf die Großbildleinwand gerichtet.
Brasilien spielt an diesem Abend, und wann immer sich die Seleção dem Tor nähert, johlt und raunt die Menge. Das brasilianische Team mit seinen Stars – das ist für viele Fußballfans hier eine große Liebe.
Es sind vor allem junge Männer aus Bangladesch, Nepal und anderen ärmeren Ländern Asiens, die sich auf den Weg in dieses Stadion gemacht haben. Sonst kämpfen im «Asian Town Cricket Stadium» Teams einer anderen Sportart um Punkte. Doch für die WM haben die Gastgeber hier eine von mehreren Fanzonen errichtet, die sich von den anderen Event-Orten des Turniers in vielem unterscheidet.
«Industrial Area» weit ab vom «Glitzer und Glanz»
Die «Fan-Zone Industrial Area», wie sie offiziell heißt, liegt am Rand der Hauptstadt Doha, mit dem Taxi rund eine dreiviertel Stunde vom Zentrum entfernt, weit weg von allem schillernden Glitzer und polierten Glanz dieses reichen Emirats. Katarer verirren sich nur selten in diese Gegend, WM-Gäste aus dem Ausland noch seltener. Die Sammelunterkünfte für die ausländischen Arbeiter sind in wenigen Gehminuten zu erreichen. Wer in die «Industrial Area» fährt, betritt eine Parallelwelt der Migranten.
Katar und seine Gastarbeiter, das ist eines der großen Themen dieser WM. Diejenigen von ihnen, die mit langen Arbeitszeiten und bei großer Hitze auf dem Bau schuften, haben den Preis dafür gezahlt, dass der Weltverband FIFA 2010 sein wichtigstes Turnier an ein Land vergab, in dem die Stadien und die Infrastruktur dafür größtenteils erst gebaut werden mussten.
Die britische Zeitung «The Guardian» recherchierte im vergangenen Jahr die Zahl von mehr als 6500 Gastarbeitern alleine aus Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesch und Sri Lanka, die seit der WM-Vergabe in Katar ums Leben kamen. Die FIFA sprach von drei Toten auf den Stadion- und anderen offiziellen WM-Baustellen, der Chef des WM-Organisationskomitees zuletzt von 414 in den Jahren 2014 bis 2020. Allein dass vor dem wichtigsten Sportereignis der Welt niemand sagen kann oder will, wie viele Menschen genau dafür ihr Leben ließen, sagt viel über diese WM aus.
Das Emirat baut auf die Arbeitsmigranten
In Katar wird schnell klar: Den klassischen Gastarbeiter gibt es hier nicht. Dafür sind es zu viele. Gastarbeiter halten dieses Land am Laufen, weil sie fast alle Tätigkeiten im Alltag verrichten, vor allem die schlecht bezahlten: der Arbeiter auf der Baustelle, die Reinigungskraft auf der Toilette, die Kassiererin im Supermarkt, der Fahrer im Bus oder Taxi. Es gibt aber auch ausländische Polizisten, Ärzte, Restaurant-Besitzer, Falkner.
Ohne Migranten wäre das Emirat trotz all seines Reichtums verloren. Rund drei Millionen Menschen leben in dem Golfstaat – nur knapp jeder Zehnte hat einen katarischen Pass. Die Menschen, die man in Katar am seltensten trifft, sind die Kataris.
Rahman, ein junger Mann aus Bangladesch, der eigentlich anders heißt, lebt seit sieben Jahren in Katar. Er trägt im Cricket-Stadion einen Brasilien-Schal und tanzt einige Schritte, als die Seleção ein Tor erzielt.
Aus 6000 Kilometern Entfernung in Deutschland mag das vielleicht widersprüchlich klingen: Für die WM ausgebeutet zu werden und sich trotzdem auf die WM-Spiele zu freuen. Aber auch Rahman sagt, dass diese Fanzone, die Spiele am Großbildschirm, die Idole aus Brasilien auch eine Abwechslung in ihrem eintönigen, arbeits- und entbehrungsreichen Leben fernab der Heimat sind. Zum Feiern kommen sie sonst nur selten.
Rahman verdient sein Geld als Taxifahrer, was für ihn heißt: sechs Tage die Woche am Steuer sitzen, bis zu zwölf Stunden am Tag, manchmal weniger. Er arbeite auf eigene Rechnung und mache rund 5000 katarische Riyal im Monat (etwa 1300 Euro), sagt er. Andere verdienen aber auch noch mit. Die Firma, die die Taxilizenz besitzt, lässt sich bezahlen. Und oft auch einheimische Sponsoren, ohne die kein Ausländer im Land bleiben darf.
Katar zwischen Realität und Reformen
Zu den Ambivalenzen in Katar gehört: Das Land am Golf hat in den vergangenen Jahren Reformen beschlossen, die die Lage der Arbeitsmigranten – zumindest auf dem Papier – verbessert haben. Sie können jetzt etwa den Job wechseln oder das Land verlassen, ohne dass der Sponsor seine Zustimmung geben muss.
Rahman erzählt, er könne in die Heimat reisen, wann und so lange er wolle. Auch Abdur, ein Kollege von ihm aus Pakistan, lebt seit elf Jahren in Katar und möchte nach dieser WM als Busfahrer nach Polen ziehen. «Mit dem neuen Gesetz», sagt er, «ist das möglich. Mit dem alten ging das nicht.»
Doch die Realität im täglichen Leben ist häufig immer noch eine andere. Menschenrechtler weisen unermüdlich darauf hin, dass die Gesetzänderungen zwar Schritte in die richtige Richtung seien, aber bei Weitem nicht ausreichten. «Die Reformen haben sich beim Schutz der Arbeitnehmerrechte als völlig unzureichend erwiesen und werden nur unzureichend durchgesetzt», bemängelt etwa Human Rights Watch.
Dieses «Aber» zieht sich durch alle Themen. Ja, die WM und die dadurch auf das Land gerichteten Scheinwerfer haben die Arbeitnehmerrechte in Katar gestärkt. Aber den Toten auf den Stadionbaustellen hilft das nicht mehr, und die Frage ist auch: Was passiert, wenn diese internationale Aufmerksamkeit nicht mehr da ist?
Wie entwickelt sich Katar nach der WM?
«Ich glaube nicht, dass diese Gesetze nach der WM wieder zurückgenommen werden», sagte der Golfstaaten-Experte Nicolas Fromm von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. «Aber ich glaube nicht, dass der Effekt dadurch so groß ist, dass es das gesamte Problem Katars im Umgang mit Arbeitsmigranten lösen wird. Denn wenn Katar auf Jahre oder Jahrzehnte ein sehr gefragter Gaslieferant bleiben wird, dann glaube ich nicht, dass im Westen starke Versuche unternommen werden, diesen Handelspartner zu diskreditieren.»
Rahman und Hassan, seit fünf Jahren im Emirat, sprechen ganz nüchtern über Katar. Aus ihren Worten ist weder Groll noch Zuneigung herauszuhören. «Das hier ist ein Land im Nahen Osten. Du kannst es nicht mit Europa vergleichen», sagt Hassan. Und er fügt noch etwas hinzu, das viele Arbeitsmigranten hier sagen: «In Katar ist es besser als in Saudi-Arabien oder in den Emiraten.» Gerade in Saudi-Arabien, dem möglichen Gastgeber der WM 2030, «sind die Regeln viel strikter.» Dort gilt zum Beispiel immer noch das in Katar offiziell abgeschaffte Kafala-System, das Migranten an einen einheimischen Sponsor bindet.
Rahman reist demnächst nach Hause, um zu heiraten. Er wird zurückkommen nach Katar, weil er hier weiter Geld verdienen will. Für immer bleiben aber möchte er nicht. «Ich habe einen Traum», sagt er. Und der heißt Europa, am liebsten Portugal: «Die vergeben Staatsbürgerschaften.» Eine katarische wird er nie bekommen.